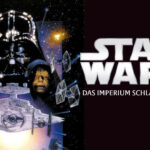J. R. R. Tolkien gilt als einer der wichtigsten Begründer des modernen Fantasy-Genres. Seine Welten aus „Der Hobbit“, „Der Herr der Ringe“ und „Das Silmarillion“ faszinieren seit Jahrzehnten Millionen von Leser:innen und Filmfans weltweit. Doch wie gelang es Tolkien, ein so dichtes und lebendiges Universum zu erschaffen, das in seiner Komplexität an echte Mythologien und Epen heranreicht? Der Schlüssel liegt in seiner Liebe zu alten Sprachen, Legenden und Mythen, die oft jahrtausendealte Wurzeln haben. In diesem umfangreichen Blogbeitrag tauchen wir tief in die Ursprünge von Mittelerde ein und decken auf, welche realen Quellen Tolkien für Figuren wie Galadriel, Aragorn, Gandalf und viele andere herangezogen hat. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf das Gilgamesch-Epos, mittelalterliche Heldendichtungen, nordische Mythen und weitere, teils vergessene Quellen.
Seiteninhalte
- 1 Die Faszination für alte Mythen und Epen
- 2 Das Gilgamesch-Epos als Ur-Mythos
- 3 Nordische Sagenwelt – Die Edda, Beowulf und Co.
- 4 Von Galadriel bis Gandalf – Charaktere und ihre Vorbilder
- 5 Die Völker Mittelerdes – Menschen, Elben, Zwerge, Hobbits und Orks
- 6 Sprache als Schlüssel: Tolkiens philologische Meisterleistung
- 7 Wichtige Ereignisse, die von Mythen inspiriert sein könnten
- 8 Zusätzliche Inspirationsquellen – Mittelalterliche, keltische und christliche Motive
- 9 Einzigartigkeit und Einfluss auf die moderne Fantasy
- 10 Ausblick – Weiterführende Forschung und Diskussion
- 11 Tolkien als Schöpfer einer eigenen Mythologie
- 12 Bonus-Tipps & weiterführende Informationen
- 13 Fazit und Abschließende Worte
Die Faszination für alte Mythen und Epen
Tolkien war nicht nur ein begnadeter Schriftsteller, sondern auch ein versierter Philologe und Linguist. Seine akademische Karriere an der Universität Oxford brachte ihn in engen Kontakt mit mittelalterlichen Texten, alten Sprachen und Mythologien. Seine besondere Vorliebe galt dem Altenglischen, dem Altisländischen und den nordischen Sagas. Doch damit nicht genug: Auch die uralte mesopotamische Dichtung, wie das Gilgamesch-Epos, fand in Tolkiens Werk subtile Spuren. Warum das alles so wichtig ist? Tolkien wollte nichts weniger, als für England eine „eigene“ Mythologie zu schaffen. Während viele Länder Europas auf reiche epische Überlieferungen zurückgreifen konnten, war er der Meinung, England besäße – nach den Einflüssen der Normannen, Sachsen und Kelten – keine geschlossene, eigenständige Mythologie mehr. So begann er, eine gigantische, fiktive Welt zu formen, die sich zugleich vertraut und uralt anfühlen sollte.
Das Gilgamesch-Epos als Ur-Mythos
Ein kurzer Blick ins Gilgamesch-Epos
Das Gilgamesch-Epos ist eines der ältesten schriftlich überlieferten Werke der Menschheit, entstanden im alten Mesopotamien (heute grob das Gebiet des Irak) um ca. 2100 v. Chr. Es erzählt die Geschichte des Königs Gilgamesch von Uruk und dessen Freundschaft zu Enkidu. Gemeinsam bestehen sie zahlreiche Abenteuer, wobei Themen wie Freundschaft, Verlust, Unsterblichkeit und Menschlichkeit im Zentrum stehen.
Parallelen zu Tolkiens Schöpfung
Obwohl Tolkien nie direkt erklärte, dass Gilgamesch eine Hauptinspiration für ihn war, lassen sich einige thematische Überschneidungen erkennen:
- Suche nach Unsterblichkeit: Gilgamesch sucht nach ewigem Leben, nachdem sein Freund Enkidu stirbt. In Tolkiens Welt ist die Frage nach Sterblichkeit vs. Unsterblichkeit essenziell – Elben sind unsterblich, Menschen sterblich. Die Figur Aragorn ringt mit seiner Rolle als Mensch, der beschieden, aber sterblich ist, während Arwen als Elbin ihre Unsterblichkeit aufgibt, um bei ihm zu sein.
- Tiefe Freundschaft: Gilgameschs intensive Bindung an Enkidu findet ein Echo in den tiefen Freundschaften der Gefährten: Frodo und Sam etwa sind ein literarisches Paradebeispiel für unerschütterliche Loyalität. Gerade Sams Hingabe erinnert stark an die emotionale Intensität, die Enkidu und Gilgamesch verbindet.
- Abenteuer und Prüfung: In Gilgamesch werden Götter und Riesen herausgefordert, in Mittelerde sind es Balrogs, Drachen oder finstere Mächte wie Sauron. Der gemeinsame Kern: Die Helden müssen über sich hinauswachsen, werden oft von göttlichen oder halbgöttlichen Wesen geprüft und müssen Opfer bringen.
Während Tolkien selbst vor allem nordische und altenglische Quellen nannte, zeigt ein genauerer Blick auf Heldenreisen und grundlegende Menschheitsthemen, dass das Gilgamesch-Epos als ein archetypisches Muster auch Mittelerde durchdringen könnte – ob bewusst oder unbewusst.
Nordische Sagenwelt – Die Edda, Beowulf und Co.
Die Edda – Quellen für Elben, Zwerge und Riesen
Die nordische Mythologie bildet vermutlich die einflussreichste Quelle für Tolkiens Werk. Die Edda – eine Sammlung altisländischer Dichtungen – beschreibt die Götterwelt um Odin, Thor und Loki, aber auch diverse mythische Wesen wie Zwerge, Riesen und Elben.
● Elben in der Edda: In den nordischen Texten sind Elben (álfar) Naturgeister oder Halbgötter. Tolkien übernahm das Konzept, verfeinerte und erweiterte es jedoch stark, um daraus die edlen Elben Mittelerdes zu entwickeln. Er verband das nordische Motiv mit eigenen Sprachschöpfungen (Quenya, Sindarin) und verlieh den Elben eine exaltierte, beinahe göttlich-anmutende Rolle.
● Zwerge (Dvergar): Schon in der nordischen Überlieferung sind Zwerge ausgezeichnete Schmiede und Handwerker. Dieser Aspekt findet sich in Mittelerde besonders in der Handwerkskunst der Zwerge (z. B. Moria, Erebor). Der Name Durin etwa stammt direkt aus den nordischen Sagen, ebenso viele weitere Zwergennamen.
Beowulf – Ein Drache, der Gold hortet
Tolkien war Professor für Altenglisch und widmete viele Forschungen dem angelsächsischen Heldenepos Beowulf. Die Geschichte von Beowulf, der gegen Monster wie Grendel und dessen Mutter kämpft und schließlich einen goldhütenden Drachen bekämpft, hat in Mittelerde unverkennbare Spuren hinterlassen.
● Smaug aus „Der Hobbit“: Ein mächtiger Drache, der auf einem riesigen Goldschatz schläft und von Bilbo herausgefordert wird – die Parallele zu Beowulfs letztem Kampf gegen den Drachen, der einen wertvollen Hort bewacht, ist offensichtlich.
● Heldenmut und Ehre: Beowulf repräsentiert den Typus des mutigen, zugleich aber tragischen Helden. In Mittelerde spiegeln Charaktere wie Thorin Eichenschild oder Aragorn ähnliche Prinzipien wider. Ehre, Pflicht und eine gewisse Schicksalshaftigkeit sind zentrale Motive.
Von Galadriel bis Gandalf – Charaktere und ihre Vorbilder

Galadriel – Eine Elbenfürstin mit mythologischer Tiefe
Galadriel gehört zu den ältesten und mächtigsten Elben Mittelerdes. Viele Fans sehen in ihr eine Anspielung auf diverse mythologische Gestalten:
- Biblische Bezüge: Einige sehen in Galadriel eine Parallele zu einer Art „Maria“-Figur, da sie Frodo in dunklen Zeiten Hoffnung und Gaben schenkt.
- Nordische Walküre: Andere argumentieren, Galadriel habe Züge einer Walküre oder einer Göttin aus der Edda, da sie über große Weisheit und seherische Fähigkeiten verfügt.
- Keltische Feenkönigin: Auch das keltische Motiv der Feenkönigin kommt ins Spiel: Eine strahlende Herrscherin über einen verzauberten Wald (Lothlórien), der Außenstehenden schwer zugänglich ist. Diese Waldkultur, das Schöne und Unnahbare, erinnert an keltische Elben- und Feenwelten.
Tolkiens eigene Aussagen deuten darauf hin, dass Galadriel vor allem von seiner Vorstellung einer makellosen Elbenfürstin geprägt war, die letztlich versucht ist, den Einen Ring zu übernehmen, sich aber dagegen entscheidet. Damit steht sie ebenso für das Motiv der Prüfung, wie Gilgamesch es erfährt, wenn er die Götter herausfordert.
Gandalf – Der Wanderer mit den Wurzeln Odins
Gandalf trägt viele Titel: Mithrandir, Gandalf der Graue, Gandalf der Weiße. Seine Figur vereint Motive aus Christentum, aber auch aus der nordischen Sagenwelt:
● Odin als Wanderer: Odin ist in vielen Geschichten ein bärtiger Wanderer, der mit Stab und Hut durch die Lande zieht, um Wissen zu erlangen. Gandalf erscheint oft als Reisender, der den Völkern Mittelerdes Hilfe bringt, aber auch Prüfungen stellt.
● Weisheit und Opfer: Odin opferte ein Auge, um tieferes Wissen zu erlangen. Gandalf opfert sich im Kampf gegen den Balrog und kehrt als Gandalf der Weiße zurück – eine Art „Wiedergeburt“ mit größerer Macht und Weisheit.
● Priesterliche Figur: Trotz seiner heidnischen Anklänge erinnert Gandalfs Rolle im Kampf gegen Sauron auch an einen Priester oder Propheten. Er führt Frodo und die Gemeinschaft, ohne sich selbst aufzudrängen, bleibt aber moralischer Wegweiser.
Aragorn – Der verbannte König
Aragorn ist ein direkter Erbe des sagenumwobenen Isildur und repräsentiert den Gedanken eines Königs, der im Exil lebt und erst spät seine wahre Bestimmung antritt:
● Artus und die Rückkehr des Königs: Die Legende von König Artus oder auch die Darstellung des rechtmäßigen Thronerben, der unerkannt aufwächst (z. B. in vielen Märchen), sind offensichtliche Inspirationen für Aragorns Geschichte.
● Beowulf und Leadership: Der heroische Aspekt, durch Tugend und Tapferkeit ein Königreich zu vereinen, ist im altenglischen Epos tief verwurzelt. Aragorn ist ein Anführer, der durch Mut, Geschick im Kampf und diplomatisches Geschick die Menschen, Elben und Zwerge eint.
Die Völker Mittelerdes – Menschen, Elben, Zwerge, Hobbits und Orks

Menschen – Zwischen Sterblichkeit und Heldentum
Die Menschen in Mittelerde sind nicht homogen: Wir treffen auf die edlen Dúnedain, die stolzen Reiter von Rohan, die kriegerischen Männer von Gondor und die oft zwielichtigen Bewohner von Umbar oder Harad.
● Historische Vorbilder: Man erkennt Einflüsse des germanischen Heerkönigtums (Rohan erinnert stark an die angelsächsische oder wikingerartige Reiterkultur). Gondor hingegen weckt Assoziationen an ein antikes Imperium mit großen Städten und Monumentalbauten (vielleicht Byzanz, Rom oder das alte Ägypten in Anklängen).
Elben – Unsterbliche Hüter der Kultur
Die Elben sind in vielerlei Hinsicht das Herzstück von Tolkiens Mythologie. Sie verkörpern eine „unverfälschte Schönheit“ und ein tiefes Verständnis der Schöpfung.
● Atlantis und das Verlorene Paradies: Die Geschichte von Aman (das Segeln nach Westen) und das Reich Valinor in „Das Silmarillion“ erinnern an viele Legenden über verschollene Paradiese und göttliche Gefilde.
● Romantische Heroik: Mit ihrer Kunst, Poesie und Musik spiegeln die Elben einen Idealzustand wider, der in vielen mittelalterlichen Epen herbeigesehnt wird. Gleichzeitig sind sie tragische Helden, die (wie Gilgamesch) der Vergänglichkeit entfliehen wollen, aber sich letztlich nicht gegen das Schicksal stellen können.
Zwerge – Stur, stolz und meisterhafte Schmiede
Angelehnt an die nordischen „Dvergar“ tragen die Zwerge eine ambivalente Rolle: Sie sind teils heldenhaft, teils streitsüchtig und von Goldgier getrieben.
● Moria und das Zwergenreich: Moria („Khazad-dûm“) zeigt die tiefe Leidenschaft der Zwerge fürs Graben und Bauen. Ein gewaltiges unterirdisches Reich, das (ähnlich wie die Höhlen in Gilgamesch oder in anderen Mythen) sowohl Faszination als auch Schrecken birgt.
● Durins Fluch: Der Balrog, den die Zwerge in Moria weckten, ist eine mythische Strafe für Hybris – ganz wie in antiken Epen, wo das Übermaß oder der Bruch göttlicher Gesetze Ungeheuer entfesselt.
Hobbits – Die unscheinbaren Helden
Hobbits sind eine von Tolkiens originellsten Schöpfungen. Dennoch weisen sie Ähnlichkeiten zu ländlichen Volkssagen Englands auf, etwa Feenwesen oder Brownies, die in Erdlöchern wohnen und eine heitere, bäuerliche Welt pflegen.
● Der Kontrast zum epischen Heldentum: Hobbits sind klein, zurückhaltend, lieben gutes Essen und ein friedvolles Leben – im Gilgamesch-Epos würde man sie kaum vermuten. Aber genau dieser Kontrast schafft die Grundlage für Frodos Heroismus.
● Tugend und Mut: Die Hobbits zeigen, dass wahres Heldentum im Innern wachsen kann, unabhängig von Größe, Abstammung oder königlichem Blut. Das ist eines der zentralen Motive in Tolkiens Werk.
Orks – Verdorbene Kreaturen
Tolkien beschreibt die Orks als grausame und entstellte Geschöpfe, die ursprünglich Elben waren, aber durch den ersten Dunklen Herrscher Morgoth entstellt und korrumpiert wurden.
● Dämonisierungen in Mythen: Viele Kulturen haben Erzählungen über „verfluchte“ oder „verdammte“ Völker. Ähnliche Narrative finden sich in skandinavischen Sagen (Trolle) oder in biblischen Geschichten (gefallene Engel).
● Wiederkehr eines Archetyps: In zahlreichen Epen stehen entartete Gegenspieler den Helden gegenüber. So kann man Orks als Echo auf all die Monster und Ungeheuer sehen, denen Helden in Mythen entgegentreten.
Sprache als Schlüssel: Tolkiens philologische Meisterleistung
Ein zentraler Aspekt von Tolkiens Welten ist die Kunstsprache. Er glaubte, dass Sprache und Mythologie eng zusammenhängen – jede Kultur schafft Mythen, um ihre Welt sprachlich zu begreifen, und jede Mythologie prägt wiederum die Sprache.
- Quenya und Sindarin: Die beiden Hauptsprachen der Elben basieren auf realen Sprachen wie Finnisch (Quenya) und Walisisch (Sindarin).
- Khuzdul (Zwergensprache): Stellt eine semitisch angehauchte Sprache dar (Tolkien deutet Einflüsse ähnlich dem Hebräischen an).
- Rohirrisch: In den Romanen nutzt Tolkien eine Form des Altenglischen, um die Kultur Rohans darzustellen.
Diese sprachlichen Konstruktionen verleihen Mittelerde eine Authentizität, die untrennbar mit den mythischen und historischen Anleihen verknüpft ist. Genau dadurch fühlt sich Tolkiens Welt an wie eine echte, gewachsene Zivilisation.
Wichtige Ereignisse, die von Mythen inspiriert sein könnten

Die Erschaffung Ardas – Anklänge an Schöpfungsmythen
In „Das Silmarillion“ beschreibt Tolkien die Schöpfung der Welt Arda. Die Ainur (göttliche Wesen) singen ein Lied, aus dem die physische Welt entsteht. Parallelen finden sich in verschiedenen Kulturen:
● Genesis und Edda: Sowohl in der Bibel als auch in den nordischen Mythen gibt es die Idee einer Ur-Schöpfung durch ein göttliches oder halbgöttliches Wesen.
● Musikalische Kosmogonie: Das Singen der Ainur ist einzigartig, doch in antiken Überlieferungen gibt es Erzählungen, in denen Welten durch Klang oder Gesang Gestalt annehmen (z. B. die vedische Tradition in Indien, in der heilige Silben die Weltordnung strukturieren).
Der Fall Númenors – Das „Atlantis“ Mittelerdes
Númenor war ein mächtiges Reich der Menschen, das durch Stolz und das Streben nach Unsterblichkeit unterging. Dieses Schicksal erinnert stark an die Atlantis-Sage:
● Parallelen zu Atlantis: Ein Inselreich, reich an Wissen und kulturellem Fortschritt, geht in einer gigantischen Flut unter.
● Hybris-Motiv: Die Númenorer waren Menschen, die von den Göttern (Valar) gesegnet, aber letztlich durch ihren Hochmut bestraft wurden. Ähnliche Erzählmuster finden sich in der griechischen Mythologie (Ikarus, Prometheus) und dem biblischen Turmbau zu Babel.
Der Ringkrieg – Epische Schlachten und das Ringen mit der Dunkelheit
Der Krieg gegen Sauron im Dritten Zeitalter ist das zentrale Ereignis in „Der Herr der Ringe“. Man erkennt typische Motive:
● Letzter großer Kampf: In vielen Mythen gibt es einen Endkampf zwischen Gut und Böse (z. B. Ragnarök in der nordischen Edda).
● Zerstörung eines Artefakts: Der Eine Ring muss vernichtet werden, um das Böse zu besiegen. Man kennt ähnliche Motive aus anderen Epen, in denen ein Symbol oder ein Herzstück des Bösen zerstört werden muss (z. B. in slawischen Märchen, wo das Herz des Ungeheuers in einem Ei liegt).
Zusätzliche Inspirationsquellen – Mittelalterliche, keltische und christliche Motive
Tolkien selbst war Katholik und zog aus seinem Glauben einige ethische und moralische Leitlinien. Gleichzeitig war er fasziniert von angelsächsischen Traditionen und keltischer Folklore. Dieses Nebeneinander spiegelt sich in vielen Elementen:
- Keltischer Einfluss: Der Name „Galadriel“ hat klanglich Ähnlichkeiten zu keltischen Elbennamen. Auch die Liebe zu Hügeln, Wäldern und heiligen Quellen in Mittelerde lässt an keltische „Heilige Haine“ denken.
- Christliche Symbolik: Besonders in Gandalfs Opfertod und Auferstehung oder in Frodos Leiden kann man Parallelen zum christlichen Erlösungsmotiv erkennen. Tolkien lehnte allerdings eine direkte Allegorie ab – er wollte lieber eine tieferliegende, unaufdringliche „Übereinstimmung“ mit christlichen Wahrheiten.
Einzigartigkeit und Einfluss auf die moderne Fantasy

Kein Autor hat die moderne Fantasy so geprägt wie Tolkien. Autoren wie George R. R. Martin („Das Lied von Eis und Feuer“), Patrick Rothfuss („Die Königsmörder-Chronik“) oder Brandon Sanderson („Das Rad der Zeit“-Fortführungen, „Die Nebelgeborenen“) haben alle auf ihre Weise von Tolkiens Methoden gelernt, sei es beim Weltenbau, bei der Sprachenentwicklung oder im Umgang mit Archetypen.
Zugleich ist Tolkiens Ansatz bis heute unnachahmlich. Kein Werk hat vergleichbar viele Ebenen – von den Göttern der Ainur bis zu den bodenständigen Hobbits, von schicksalhaften Königen bis zu gebrochenen Gestalten wie Gollum. Hier treffen wir auf die Essenz jahrtausendealter Menschheitsgeschichten, die Tolkien in ein neues Gewand gehüllt hat.
Ausblick – Weiterführende Forschung und Diskussion
Auch Jahrzehnte nach Tolkiens Tod wird geforscht und diskutiert, welche Quellen er noch nutzte. Immer wieder tauchen Manuskripte auf, die neue Einblicke in seine frühen Entwürfe geben. Fan-Theorien, akademische Aufsätze und sogar ganze Tolkien-Konferenzen widmen sich der Frage: „Woher stammt eigentlich dieses oder jenes Motiv?“
● Literaturwissenschaft: Forscher:innen entdecken stetig neue Querverweise, etwa auf angelsächsische Chroniken oder walisische Sagen.
● Internet-Communities: Online-Portale wie Ardapedia oder das Tolkien Gateway bieten eine Fülle an Information und Diskussionen rund um dieses Thema.
● Neue Medien: Streaming-Serien, Computerspiele und Fanfilme lassen Tolkiens Welt weiterleben und setzen eigene Schwerpunkte, die wieder neue Fragen aufwerfen, wie weit wir uns von der originalen Mythologie entfernen sollten.
Tolkien als Schöpfer einer eigenen Mythologie
Was Tolkien in seinen Werken leistet, ist mehr als nur das Zitieren einzelner Mythen oder Epen. Er webt die Themen Unsterblichkeit, Freundschaft, Verrat, Gier, Erlösung und Tapferkeit zu einer einzigartigen, monumentalen Mythologie. In gewisser Weise ist „Der Herr der Ringe“ eine Synthese aus zahlreichen Traditionen – von Gilgamesch über die nordischen Sagen bis hin zu christlichen und keltischen Motiven.
Dieser reiche Einfluss erklärt, warum Mittelerde so tiefgründig und vertraut wirkt: Die Geschichten knüpfen an archetypische Urängste und -sehnsüchte der Menschheit an. Gleichzeitig ist Tolkiens Werk aber kein Patchwork, sondern eine kohärente Welt mit eigener Geschichte, eigenen Sprachen und Völkern.
Bonus-Tipps & weiterführende Informationen
- Weitere Lektüre
○ „Das Silmarillion“: Hier findest du die Frühgeschichte Ardas, die Schöpfungsgeschichte und erste Kriege gegen Morgoth.
○ „Nachrichten aus Mittelerde“: Enthält zusätzliche Erzählungen zu Elben, Menschen und verschiedenen Zeitaltern.
○ „Beowulf: A Translation and Commentary“ von J. R. R. Tolkien selbst: Spannend, um Tolkiens Gedanken zu mittelalterlichen Epen zu verstehen. - Sprachliche Studien
○ Wer tiefer in die Elbensprachen eintauchen will, findet im Internet zahlreiche Ressourcen zur Grammatik von Quenya und Sindarin. - Mythologische Vergleiche
○ Lies die Edda, das Gilgamesch-Epos oder Artusepik (z. B. Thomas Malorys „Le Morte d’Arthur“), um Parallelen zu entdecken.
Fazit und Abschließende Worte
Von Gilgamesch bis Galadriel – Tolkiens Inspirationsquellen sind so umfangreich, dass es unmöglich wäre, sie in einem einzigen Blogartikel vollständig zu beleuchten. Doch genau darin liegt die Magie seines Schaffens: Indem er uralte Mythen und Legenden mit eigener Sprachkunst und tiefen moralischen Fragestellungen verband, erschuf er ein literarisches Universum, das uns bis heute nicht loslässt.
Ob du nun Einsteiger:in bist oder seit Jahren jedes Detail in „Der Herr der Ringe“ analysierst – Tolkiens Kombination aus epischer Größe, mythischer Tiefe und liebevoller Detailverliebtheit ist einzigartig. Wer sich weiter damit befasst, entdeckt immer neue Schichten und erkennt, wie meisterhaft Tolkien die unterschiedlichen Quellen verarbeitet hat, um sie zu etwas wahrhaft Neuem zu vereinen.
So bleibt Mittelerde lebendig – ein Ort, an dem sich unsere Sehnsüchte und Albträume, unsere Hoffnungen und Ängste spiegeln. Ein Ort, der uns erinnert, dass die größten Geschichten niemals allein aus der Fantasie entstehen, sondern immer auch aus dem gemeinsamen Erbe der Menschheit. Und genau das macht „Von Gilgamesch bis Galadriel“ zu einer Reise, die wir immer wieder antreten können, um in der Tiefe zu ergründen, wie Tolkiens Charaktere zu dem wurden, was sie sind: zeitlos
Die Rechte an den hier verwendeten Bildern liegen bei den jeweiligen Filmstudios und Verleihern. Die Verwendung erfolgt ausschließlich zu illustrativen Zwecken im Rahmen der Berichterstattung.
Der Herr der Ringe – Studio: New Line Cinema | Verleiher: Warner Bros. Pictures
Der Hobbit – Studio: New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), WingNut Films | Verleiher: Warner Bros. Pictures
Originally posted 2025-02-16 16:09:40.